Ausgabe 37 · Januar 2024
Gelesen
Jürgen Isendyck: Fahrrad verstehen. Ein illustrierter Grundwortschatz
rezensiert von Juliane Neuß

Fahrrad verstehen.
Ein illustrierter Grundwortschatz.
radundbuch.de, 2019.
184 Seiten, über 1.000 Illustrationen.
ISBN 978-3-9820070-3-8
19,80 €
Gut, dass uns der Untertitel gleich in die richtige Richtung weist. Es geht nicht um Esoterik und das Seelenleben unserer geliebten Fahrräder, sondern um Begreifen und Verständlichmachen.
Sehen und verstehen, welches Bauteil da eigentlich vorne über dem Rad hängt oder wie das Ding heißt, auf das man tritt. Banal? Mitnichten!
Wer schon mal Kunden im Fahrradladen oder in einer Selbsthilfewerkstatt erlebt hat, weiß, was ich meine. Die Frage »was für ein Fahrrad ist es denn?« wird dann gerne mit »ein ganz normales« beantwortet. Wie soll man da helfen?
Jürgen Isendycks Buch versucht, Abhilfe zu schaffen. Und zwar nicht mit der endlosen Aneinanderreihung von Marketingtexten und dem »neusten« Stand der Technik, sondern mit Grundlagen der Fahrradtechnik, die sich nicht in modischen Details verliert, sondern klarstellt.
Sein Blick geht dabei immer auch zurück in die Fahrradgeschichte, die für ihn genauso Grundlage ist wie ein sicherer Blick für technisch wichtige Details und Grundlagen des Maschinenbaus.
Das Besondere an seinem Buch sind die zarten Zeichnungen, die präzise die wichtigsten Details zeigen und unwichtiges Beiwerk gekonnt weglassen. Dadurch kann man sich auf die Funktion und die Lage des Bauteils konzentrieren, was bei fotografischen Produktbildern nicht möglich wäre.

Der Aufbau des Buches beginnt mit der Geschichte des Fahrrads, was durchaus seine Berechtigung hat, denn nur, wenn man weiß, wie das alles entstanden ist, versteht man letztendlich, warum Entwicklungen in der Fahrradtechnik lebendige, nie endende Prozesse sind. Es gibt kaum einen anderen Gebrauchsgegenstand, der sich dem Menschen immer wieder aufs Neue anpasst und den Bedürfnissen entsprechend verändert. Gleichzeitig kann man eine gewisse Kontinuität beobachten, wenn Dinge zwar verändert werden, aber später in die ursprüngliche und bewährte Form zurückfinden. Das ist auch der Grund, warum dieses Buch so sinnvoll ist. Fahrradtechnische Grundlagen, physikalische Gesetze und Ergonomie können zwar modische Aspekte beinhalten, sind aber letztlich immer konstant.
Fahrradphysik und Ergonomie sind dann auch die nächsten Kapitel, gefolgt von Rahmenbau, Federung und Fahrradtypen, bevor es dann in die Details des »normalen« Fahrrads geht.
Fast jedes der folgenden Kapitel hat ein Unterkapitel, was »Entwicklung von …« heißt. Auch hier wieder der analytische Blick zurück: Wie ist das Bauteil entstanden, welche geschichtlichen und teilweise sportpolitischen Hintergründe gab es?
Natürlich ist »Fahrrad verstehen« auch eine Momentaufnahme, aber eine sehr universelle. Vermutlich werden wir in 20 Jahren über die Inhalte lächeln oder ein verträumtes »Weißt du noch?« von uns geben, aber es wird auch dann noch unverrückbare Wahrheiten geben, die in diesem Buch spürbar liebevoll argumentiert wurden und weiterhin aktuell sind.
Für wen ist dieses Buch eigentlich gedacht?
Wenn man nicht schon 30 Jahre in der Schrauberecke tätig ist, dann für jeden. Speziell denke ich an Selbsthilfewerkstätten oder Gruppierungen, die immer mal wieder was mit Fahrradtechnik zu tun haben und einfach etwas fundierter die Fachbegriffe verwenden oder den Überblick bekommen wollen.
Besonders wertvoll sind die Begleittexte neben den Zeichnungen, die knapp und präzise auf den Punkt kommen. Ich wünschte, jeder Fahrradhändler und jede Werkstatt würden dieses Buch kennen. Dann wäre vielen geholfen.
Zur Rezensentin
 Juliane Neuß, von
Beruf Technische Assistentin für Metallographie und Werkstoffkunde. Ihre
Berufung: Fahrradergonomie und Fahrräder für kleinwüchsige Menschen.
Betreibt seit 1998 die Firma Junik-Spezialfahrräder, hat sechs Jahre
lang die Filiale eines Fahrradladens in Hamburg geleitet und viele Jahre
den Techtalk in der ADFC-Radwelt geschrieben. Sie ist seit 2016
Inhaberin der »Fahrradschmiede 2.0« in Clausthal-Zellerfeld, ihrem
Heimatort, und hat dort auch eine Brompton-Spezialwerkstatt.
Juliane Neuß, von
Beruf Technische Assistentin für Metallographie und Werkstoffkunde. Ihre
Berufung: Fahrradergonomie und Fahrräder für kleinwüchsige Menschen.
Betreibt seit 1998 die Firma Junik-Spezialfahrräder, hat sechs Jahre
lang die Filiale eines Fahrradladens in Hamburg geleitet und viele Jahre
den Techtalk in der ADFC-Radwelt geschrieben. Sie ist seit 2016
Inhaberin der »Fahrradschmiede 2.0« in Clausthal-Zellerfeld, ihrem
Heimatort, und hat dort auch eine Brompton-Spezialwerkstatt.
Motonormativity
rezensiert von Stefan Buballa
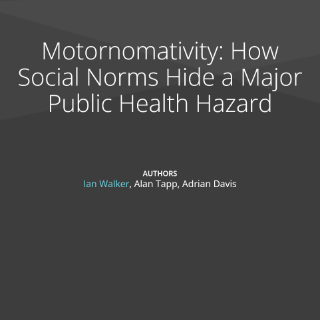
Motonormativity: How Social Norms Hide a Major Public Health Hazard.
International Journal of Environment and Health, 2022.
DOI: 10.31234/osf.io/egnmj
Einführung
Angst vor Klimawandel hin oder her, jeder, der sich mit der notwendigen Verkehrswende beschäftigt, stößt in Bezug auf den motorisierten Individualverkehr auf Granit. Dass Verkehr in erster Linie Autoverkehr bedeutet, scheint unhinterfragbar, »selbstverständlich«. Deutsche Verkehrsminister sind, so lange sie im Amt sind, immer Autolobbyisten und werden dafür von der Automobilindustrie nach ihrem Ausstieg aus der aktiven Politik manchmal auch mit einem Posten belohnt.
Dementsprechend sehen Verkehrsplanung, Raumordnungs- und Gesundheitspolitik aus: Nicht nur Baumärkte, auch öffentliche Einrichtungen wie Spitäler werden selbstverständlich so geplant, dass sie per Auto optimal nutzbar sind. Schließlich wurden auch die vielfältigen gesundheitlichen Auswirkungen dieser gesellschaftlich bedingten übermäßigen Autonutzung entweder individualisiert (»sollte halt öfters ins Fitness«) oder mit einer noch aggressiveren Ausweitung einer autogerechten Raumplanung beantwortet: »Das Haus im Grünen«, das die lieben Kinder vor dem »selbstverständlichen« Lärm, der »normalen« Unfallgefahr und »typischen« Luftverschmutzung der Städte schützt, ist natürlich ebenfalls nur per Auto in erträglicher Zeit zu erreichen. So weit, so schlecht.
Diese Selbstverständlichkeit der übermäßigen Autonutzung ist kulturell aber derart tief verankert, dass sie vielen Menschen, vor allem aber auch vielen Politiker:innen und Gesundheitsfachpersonen gar nicht mehr bewusst ist.
Hier setzt die Untersuchung an, die ich hier vorstellen möchte. Die Autoren möchten untersuchen, ob die vermutete, oben skizzierte, verzerrte Wahrnehmung im Bereich »Auto und Gesundheit« wirklich existiert.
Methoden
Die Autoren der Studie entwickelten fünf Fragen, die jeweils in einer »Auto«- und einer »kein Auto«-Version formuliert sind und zufällig zugewiesen wurden. Bei den Fragen wird die Akzeptanz von gesundheitsschädlichem (oder egoistischem) Verhalten in Abhängigkeit des Kontextes (»Auto« versus »kein Auto«) abgefragt. Es geht in den Fragen hauptsächlich um allgemein bekannte Gesundheitsrisiken in Alltagssituationen.
Beispiel:
»Menschen sollten nicht in Bereichen Auto fahren, in denen sich viele
Menschen aufhalten, die die Autoabgase einatmen müssen.«
versus
»Menschen sollten nicht in Bereichen rauchen, in denen sich viele Menschen
aufhalten, die den Zigarettenrauch einatmen müssen.«
Um eine ausreichend große, repräsentative Stichprobe für einen nicht kommerziell nutzbaren Forschungsgegenstand sicherzustellen, sind die Fragen in einen Fragebogen integriert, den ein Meinungsforschungsinstitut »seinen« festen Teilnehmer:innen regelmäßig zuschickt. Da es in diesen Fragebogen um verschiedene Themen geht, wird so auch der eigentliche Gegenstand der Untersuchung verschleiert, was der Qualität der Antworten zugutekommt.
Ergebnisse und Diskussion
Die statistische Auswertung der Antworten zeigte, dass ein Auto-Kontext in der Frage gesundheitsschädlichen Verhaltens im Gegensatz zu einem »Nicht-Auto-Kontext« signifikant akzeptabler macht. Besonders spannend fand ich dabei, dass dies auch der Fall ist, wenn die/der Teilnehmer:in gar nicht Auto fährt! Autofahren und dabei die Gesundheit anderer (und die eigene) zu gefährden wird wirklich von der breiten Mehrheit der Studienteilnehmer:innen als quasi natürlich und dementsprechend unvermeidlich angesehen.
In Bezug auf die Ursachen vermuten die Autor:innen eine schon im Kindesalter beginnende, kulturell verankerte Prägung: Kleine Kinder bekommen Autos als Spielzeug, sehen ihre Eltern das Auto auch für Kurzstrecken verwenden usw. Wenn sie etwas älter sind, wird ihnen vermittelt, dass sie im öffentlichen Raum ständig mit legitimer (!) tödlicher Gefahr rechnen müssen und ihren Bewegungs»Spiel«Raum dementsprechend einzuschränken haben.
Der Straßenraum, in der Zeit vor der Motonormativität selbstverständlich von allen Menschen genutzt, ist heute für die Nutzung durch spielende Kinder völlig tabu. Später, als Erwachsene, prägt sie nicht nur die herrschende Verkehrspolitik, die vielfältige Subventionierung der Autonutzung und die Externalisierung der diesbezüglichen gesellschaftlichen Kosten. Nein, sie erleben auch, dass die Übertretung von Verkehrsregeln, zumindest wenn sie zulasten nicht motorisierter Verkehrsteilnehmer:innen geschieht, nur lasch sanktioniert wird (z. B. Parken auf Gehwegen). Auch ist illegales, gefährliches Verhalten wie zu hohe Geschwindigkeit geradezu ein Kavaliersdelikt, wird doch vor Verkehrskontrollpunkten (»Blitzer«) sogar in einigen Radioprogrammen gewarnt und damit die Durchsetzung der diesbezüglichen Schutzbestimmungen sabotiert. Und dies, obwohl in Deutschland nicht angepasste Geschwindigkeit eine der häufigsten Unfallursachen ist.
Schließlich dominieren auf einer übergeordneten kulturellen Ebene in Werbung und Unterhaltung Bilder, die eindeutig motorisierten Individualverkehr als die fast schon glorifizierte Norm darstellen. Ich dachte bis zur Lektüre dieser Untersuchung dabei immer an die Autowerbung mit braun gebrannten Männern in den »besten Jahren«, die souverän und sich ihres Status voll bewusst ihren SUV durch wunderschöne Naturlandschaft ohne Ampeln und Stau steuern. Aber auch die cineastische Ikone motornormativer Männlichkeit, James Bond, ist auf einem Hollandrad oder in der Straßenbahn nur schlecht vorstellbar.
In all diesem sehen die Autoren eine »Normalisierung von abweichendem Verhalten«, denn eine Maschine, deren Nutzung wöchentlich 35 Todesfälle (allein in Großbritannien) mit sich bringt, könnte heute niemals zugelassen werden.
Abschließend diskutieren die Autoren Forderungen an die Politik, die eine Veränderung dieser verzerrten Wahrnehmung bewirken könnten.
Zum einen sei es wichtig, in Gremien, die sich mit Verkehrspolitik im weitesten Sinne beschäftigen, ausreichend Vertreter:innen des nicht motorisierten Verkehrs zu integrieren. Zum anderen sei es im medizinischen Bereich bedeutsam, übermäßige Autonutzung als Risikofaktor zu betrachten und diese Erkenntnis auch in Präventionsstrategien zu integrieren.
Zum Rezensenten
 Stefan Buballa, Arzt,
Alltags- und Reiseradler. Selbstbau eines Reiserades und eines
Alltags-Kurzliegers. Er ist fasziniert von der Schlichtheit und
ökologischen Effizienz muskelkraftbetriebener Fahrzeuge. Besondere
Interessen: ergonomische und leistungsphysiologische Aspekte. Besondere
Schwächen: Radreisen in Afrika und Nahost ...
Stefan Buballa, Arzt,
Alltags- und Reiseradler. Selbstbau eines Reiserades und eines
Alltags-Kurzliegers. Er ist fasziniert von der Schlichtheit und
ökologischen Effizienz muskelkraftbetriebener Fahrzeuge. Besondere
Interessen: ergonomische und leistungsphysiologische Aspekte. Besondere
Schwächen: Radreisen in Afrika und Nahost ...